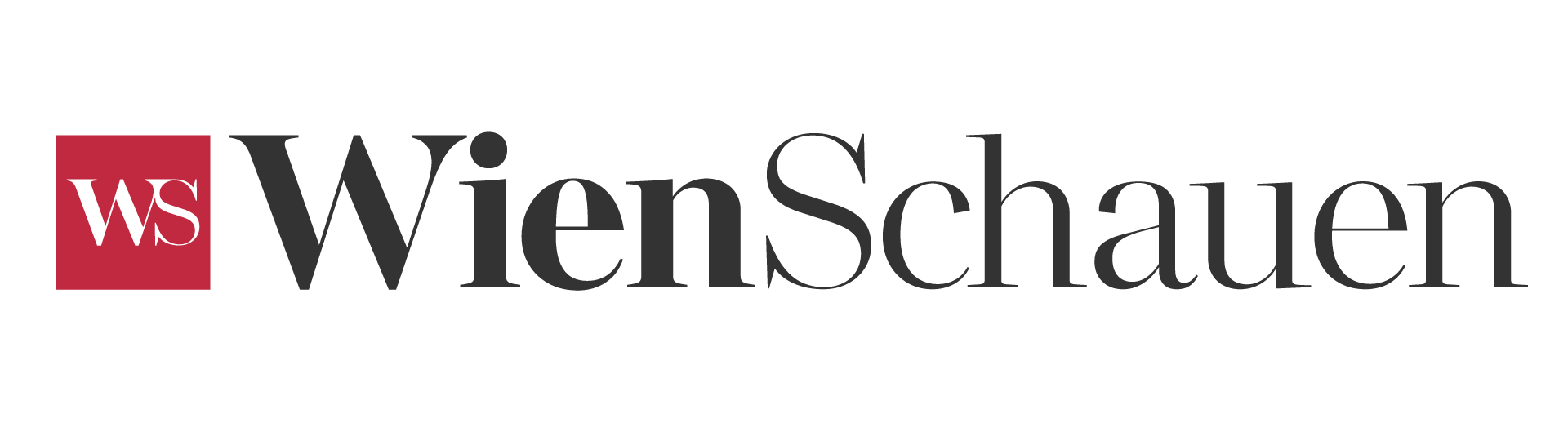Die Praterstraße hat sich im Lauf des 20. Jahrhunderts stark gewandelt. Der breite Boulevard, auf dem immer schon viel Verkehr herrscht, wurde nach und nach zu einer stark befahrenen Autostraße.
Dieser 2019 erschienene Artikel wurde mehrmals aktualisiert (zuletzt im März 2024).
Von der Kutsche zum Kraftfahrzeug
Eine echt Autobahn war die Praterstraße natürlich nie. Auch keine Schnellstraße. Das Gefühl mag trotzdem manchmal aufgekommen sein, wenn der motorisierte Verkehr sich auf vier Fahrspuren mitten durch den 2. Bezirk wälzte. Die Praterstraße liegt auch in einem Wohngebiet, sie ist immer noch eine Geschäftsstraße und keine periphere Verkehrsader. Lärm und Autoverkehr wirken sich also um so stärker aus.
Obwohl der Praterstraße als Verbindung zwischen Stadtzentrum und Prater eine einzigartige Bedeutung zukommt, wurde sie lange Zeit nur wenig beachtet. Die Bedürfnisse von Fußgängern und Radfahrern wurden hintangehalten, der Autoverkehr priorisiert. Das änderte sich 2019, als unter der damaligen Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger (Grüne) erstmals Pläne für eine Neugestaltung der Oberfläche und eine Neuordnung der Verkehrsflächen angekündigt wurden.[1] Diese Pläne wurden nach dem Wechsel von Rot-Grün zu Rot-Pink abgeändert. Gebaut wird seit 2023. Zeit für einen Blick zurück in die Vergangenheit.
Alte Prachtstraße
Die etwa einen Kilometer lange Praterstraße, die bis 1862 den Namen Jägerzeile trug, wird von einer Vielzahl bedeutender historischer Gebäude gesäumt. Bedingt durch die Zerstörungen des 2. Weltkriegs, die Zunahme des KFZ-Verkehrs, die bis in die 1990er-Jahre anhaltende Schrumpfung der Wiener Bevölkerung und zahlreiche Umbauten ist bis heute nur noch ein herber Charme geblieben.
Praterstraße im 19. Jahrhundert
Praterstraße um 1900
Carltheater
Das 1847 erbaute Carltheater in der Praterstraße Nr. 31 wurde nach Bombenschäden aus dem Zweiten Weltkrieg in den 1950ern abgerissen.
Am Bauplatz des Carltheaters wurde in den 1970ern ein Bürohaus errichtet, das 2002 zum „Galaxy-Tower“ ausgebaut worden ist.
Dogenhof
Bis heute nahezu unverändert erhalten ist der 1898 erbaute Dogenhof in der Praterstraße Nr. 70, nicht weit entfernt vom Praterstern.
Praterstraße 1954
Alte Straßenbeleuchtung entfernt
Die historischen Straßenlaternen – hier das Modell „Bischofsstab“ – und kleinere Leuchten wurden bei Umbauten etwa in den 1930ern durch andere Modelle ersetzt. In der Zweiten Republik sind auch diese Straßenlaternen demontiert und durch Hängeleuchten ersetzt worden (siehe Fotos unten). Von jenen in Wien früher stark präsenten kunstvollen Laternen gibt es – selbst in Form von Nachbauten – heute so gut wie keine mehr.
Praterstraße um 1980
Die Straßenbahnen, die seit dem 19. Jahrhundert Teil der Praterstraße gewesen waren, sind verschwunden. Mit dem Bau der U-Bahn zwischen Schwedenplatz und Praterstern wurden 1981 auch die Gleise entfernt. Die damit gewonnenen Flächen ermöglichten die Pflanzung von Bäumen, die indes beträchtliche Höhen erreicht haben. Und auch der motorisierte Individualverkehr erhielt mehr Raum.
Was tun mit dem PKW-Verkehr?
Die Anforderungen und Wünsche an die Stadt und den öffentlichen Raum haben sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Spätestens seit dem Umbau der Mariahilfer Straße und den vielen darauf folgenden Begegnungszonen (bspw. Lange Gasse, Herrengasse, Schleifmühlbrücke, Otto-Bauer-Gasse) preschen immer mehr Parteien mit Forderungen nach Umgestaltungen bestehender Straßen vor – etwa für die Landstraßer Hauptstraße, die Kettenbrücke und die Gumpendorfer Straße.
So kommt auch die Praterstraße in den Blick, die in ihrer Gestaltung nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Die Kritik vonseiten der Bevölkerung und politischer Parteien wird lauter. Im Zentrum steht die heikle Frage, wie viel Platz künftig dem Autoverkehr eingeräumt werden soll, der aktuell auf dem längsten Abschnitt sechs Spuren für sich beansprucht – vier Fahrspuren und zwei Parkspuren. Nachdem es sich größtenteils um bloß durchfahrenden Verkehr handelt, ergeben sich für den Bezirk und seine Bewohner noch mehr Nachteile.
Autoverkehr nimmt auf vielen Straßen ab
Der zweite Bezirk ist einer jener Bezirke Österreichs mit den wenigsten KFZ pro Einwohner. 2017 kamen laut VCÖ 310 Autos auf 1000 Einwohner, während es etwa im nördlichen Waldviertel doppelt so viele waren.[3] Dass die Zahl der PKW in absoluten Zahlen in einigen (aber nicht allen) Wiener Bezirken trotzdem zunimmt, ist dem starken Bevölkerungswachstum geschuldet.
Nichtsdestoweniger geht der PKW-Verkehr auf vielen Straßen langsam zurück. Beispielsweise waren in der Lassallestraße, die die Praterstraße Richtung Donaustadt verlängert, im Jahr 2015 um 6000 Autos pro Tag weniger unterwegs als noch 1995 – trotz gestiegener Einwohnerzahl. Die Fahrgastzahlen der Wiener Linien wuchsen im selben Zeitraum um über 36%.
Grüne wollen Umgestaltung
2015 sprachen sich die Grünen im Bezirk für eine Umgestaltung aus. Im Zentrum der Überlegungen stand ein Rückbau der KFZ-Fahrspuren und eine Attraktivierung für Fußgänger und Radfahrer. Grünen-Verkehrssprecher Rüdiger Maresch regte 2016 eine Reduktion der Fahrspuren von vier und zwei an, was der damalige Bezirksvorsteher Karlheinz Hora (SPÖ) jedoch gemeinsam mit FPÖ und ÖVP ablehnte. Hora befürchtete ein Verkehrschaos und eine Verlagerung des durchfahrenden Verkehrs auf die Seitengassen.[2]
Dass ein Rückbau von Fahrspuren nicht zwangsläufig zu Problemen führen muss, könnte ein Vergleich mit dem Jahr 2008 nahelegen: Im Rahmen der Fußball-EM wurde damals ein Teil der Ringstraße für einen Monat komplett gesperrt und zu einer Fanmeile umfunktioniert. Zu dem befürchteten Zusammenbruch des Verkehrs ist es nicht gekommen. Überdies sprechen sich in Österreich selbst zwei Drittel der Autofahrer für Verkehrsberuhigung in Städten aus, wie in einer repräsentativen Umfrage herausgefunden worden ist.[4]
Die von der FPÖ angefochtene und daraufhin wiederholte Bezirkswahl drehte 2016 die Machtverhältnisse in der Leopoldstadt: Noch vor der seit 1945 dominierenden SPÖ wurden die Grünen stimmenstärkste Partei. Mit Uschi Lichtenegger wurde eine Spitzenkandidatin Bezirksvorsteherin, die sich klar für eine Neugestaltung der Praterstraße aussprach. Sie sah einen klaren Wunsch in der Bevölkerung nach einer Beruhigung des Verkehrs.[5] Bei der Wahl im Jahr 2020 holte die SPÖ den Sessel des Bezirksvorstehers zurück.
Studie: Weniger Fahrspuren und weniger Tempo möglich
Den Forderungen der damaligen Bezirksvorsteherin Lichtenegger gingen eine Studie der technischen Universität Wien voraus, in der die Möglichkeiten und Auswirkungen einer Verkehrsberuhigung analysiert wurden. Die derzeit von etwa 21.000 Fahrzeugen pro Tag befahrene Praterstraße könnte demnach so adaptiert werden, dass je eine Fahrspur pro Richtung entfällt, ohne dass die Erreichbarkeit für den KFZ-Verkehr abnimmt. Damit würde Platz für Fußgänger und Radfahrer geschaffen.
Gemäß der Studie ließe sich auch die Reduktion von Ladezonen „durch Einrichtung von Ersatzladezonen in Nebengassen bzw. durch die Staffelung von Lieferzeiten kompensieren.“ Auch seien die bestehenden Parkgaragen in der Lage, die durch den Entfall der Kurzparkplätze benötigen Stellplätze zur Verfügung zu stellen.
Den Autoren der Studie, Ulrich Leth und Harald Frey, scheint zur „Hebung der Verkehrssicherheit und Minderung der Lärmbelastung eine Tempo 30-Beschränkung auf der gesamten Strecke zweckmäßig.“ Die damalige grüne Bezirksvorstehung hatte eine Reduktion der Geschwindigkeit zumindest in der Nacht auf 30 km/h angeregt, was auf starke Ablehnung bei anderen Parteien und den Autofahrerklubs stieß.[6]
Gesundheitsrisiken durch Lärm und Unfälle
Dass es auf der Praterstraße nicht unbedingt leise zugeht, ist bekannt. Mit einer Belastung von über 70 Dezibel werden die laut Weltgesundheitsorganisation für Wohngebiete empfohlenen Höchstwerte erheblich überschritten.[7] Bei dauerhaft hoher Lärmbelastung ist u.a. das Risiko für Herz-Kreislaufstörungen signifikant erhöht.[12]
Verbürgt sind die Vorteile von Tempo 30 in Bezug auf Verkehrssicherheit und Lärm: „Es ist zum Beispiel so, dass (…) schwere Unfälle mit Todesopfern bei Kindern um die Hälfte zurückgegangen sind durch die Umstellung von Tempo 50 auf Tempo 30.“ Auch komme es bei der Senkung der Geschwindigkeit von 50 auf 30 km/h fast zu einer Halbierung der wahrgenommenen Lärmbelästigung. Eine Verringerung des Schadstoffausstoßes dürfte es bei einer Reduktion auf Tempo 30 jedoch nicht zwangsweise geben.[13]
Opposition will Fahrspuren erhalten
Scharfe Kritik an einer möglichen Neuordnung des Verkehrs kam von der FPÖ, die befürchtete, „dass es am Ende des Tages nicht bei der derzeitigen Anzahl der Fahrspuren bleiben wird. Und das wäre eine echte Katastrophe für alle Verkehrsteilnehmer“, so Bezirksparteiobmann Wolfgang Seidl.[8] Er befürchtete eine Schikane für die Wiener Autofahrer und eine Einschränkung für Pendler.
Skeptisch äußerte sich auch die Leopoldstädter ÖVP, die eine Spurverengung auf der Praterstraße für nicht tragbar hielt. „Die Praterstraße ist eine wichtige Verbindungsstraße zwischen den Bezirken. Hier (…) eine Fahrspur wegzunehmen und eine 30er Beschränkung einzuführen, ist absolut inakzeptabel und würde eine massive Verdrängung in die benachbarten Wohngrätzl bedeuten“, so Bezirksparteiobfrau Sabine Schwarz.[9] Auch der ÖAMTC hält den Wegfall eines Fahrstreifens für nicht vorstellbar und fordert den Verkehrsfluss zwischen Innenstadt und Praterstern unbedingt zu erhalten.[5]
Ein alternativer Vorschlag kam von NEOS, die zwar alle vier Fahrspuren erhalten wollten, stattdessen aber Umgestaltungen angrenzender Gassen und Plätze durch Begegnungszonen favorisierten. Auch plädierte die Partei für einen breiten Zweirichtungsradweg auf einer Straßenseite. Was mit den Parkplätzen geschehen sollte und ob die Partei eine Temporeduktion befürwortete, geht aus Presseaussendung nicht hervor.[10]
Umbaupläne 2020 vorgestellt
Im September 2020 – kurz vor der Wien-Wahl – wurden Pläne für eine umfangreiche Umgestaltung vorgestellt.[11] Nach der Wahl und dem Wechsel von Rot-Grün zu Rot-Pink – im 2. Bezirk von Grün zu Rot – wurden diese Pläne zwar vorerst auf Eis gelegt, in abgeänderter Form aber von 2023-2024 umgesetzt.
Die folgenden Überlegungen bzw. Wünsche sind noch aus der Zeit des Erscheinens dieses Artikels (2019):
- Der graue Asphalt auf den Gehsteigen könnte durch farblich ansprechende Platten oder Steine ersetzt werden.
- Durch eine Reduktion von Parkplätzen im südlichen Straßenabschnitt ließe sich Raum für andere Verkehrsteilnehmer und Bäume schaffen.
- Die Senkung der Höchstgeschwindigkeit wäre für die ansässige Bevölkerung und für die vielen Unternehmen und Lokale bestimmt eine spürbare Entlastung.
- Eine Aufwertung des kaum als solchen wahrnehmbaren Nestroyplatzes durch Schaffung von Begegnungszonen beim Galaxy Tower und vor dem Nestroyhof birgt gerade aus wirtschaftlicher und touristischer Sicht enormes Potential.
- Ob Fahrspuren entfallen können oder nicht, das können Verkehrsexperten wahrscheinlich besser beurteilen als um Wählerstimmen buhlende Bezirksparteien. Es wäre schade, würde die Politik sich einer möglichen positiven Veränderung einfach aus Prinzip verschließen.
- Warum nicht auch gleich die hohen alten Straßenlaternen rekonstruieren?
Praterstraße 2019: Vom Donaukanal zum Praterstern
Kontakte zu Stadt & Politik
- SPÖ: kontakt@spw.at, Tel. +43 1 535 35 35
- ÖVP: info@wien.oevp.at, Tel. +43 1 51543 200
- Die Grünen: landesbuero.wien@gruene.at, Tel. +43 1 52125
- NEOS: wien@neos.eu, Tel. +43 1 522 5000 31
- FPÖ: ombudsstelle@fpoe-wien.at, Tel. +43 1 4000 81797
(Die Reihung der Parteien orientiert sich an der Anzahl der Mandate im November 2020.)
Verfall und Abrisse verhindern: Gemeinsam gegen die Zerstörung! (Anleitung mit Infos und Kontaktdaten)
Quellen
- [1] Praterstraße Neu: Planungsprozess für Attraktivierung startet (Presseaussendung, 4.3.2019)
- [2] Bezirksvorsteher Hora: „Reduzierung der Praterstraße führt zu Verkehrschaos“ (meinbezirk.at, 2.6.2016)
- [3] VCÖ: In neun Wiener Bezirken ist trotz Bevölkerungswachstum Zahl der Autos seit 2005 gesunken (2018)
- [4] Mehr Lebensqualität in Städten durch platzsparende Mobilität (Factsheet des VCÖ, ca. 2014)
- [5] Neue Pläne für die Praterstraße sorgen für Wirbel (Der Standard, 27.7.2018)
- [6] Praterstraße: Tempo 30 bei Nacht? (ORF, 27.7.2018)
- [7] Handbuch Umgebungslärm (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft, 2009)
- [8] FP-Seidl/Lindenbauer: Wegfall von Fahrspuren in der Praterstraße zu befürchten (Presseaussendung, 4.3.2019)
- [9] Juraczka/Schwarz: Vernunft und Hausverstand bei Neugestaltung Praterstraße gefordert (Presseaussendung, 4.3.2019)
- [10] NEOS Wien: Neugestaltung der Praterstraße – die Ergebnisse der Bürger_innenbefragung (Presseaussendung, 11.3.2019)
- [11] Vizebürgermeisterin Hebein will auf Wiener Praterstraße eine Pkw-Fahrspur entfernen (Der Standard, 16.9.2020)
- [12] Wie laut ist welcher Lärm? (Süddeutsche Zeitung, 17.5.2010)
- [13] Studie: Tempo 30 bringt Umwelt nicht viel (ORF, 3.6.2014)
- „Prachtboulevard“ Praterstraße: Erste Ergebnisse im Frühjahr (Kurier, 4.3.2019)
- Alle nicht gekennzeichneten Fotos sind © Georg Scherer/wienschauen.at
WienSchauen.at ist eine unabhängige, nicht-kommerzielle und ausschließlich aus eigenen Mitteln finanzierte Webseite, die von Georg Scherer betrieben wird. Ich schreibe hier seit 2018 über das alte und neue Wien, über Architektur, Ästhetik und den öffentlichen Raum.
Wenn Sie mir etwas mitteilen möchten, können Sie mich per E-Mail und Formular erreichen. WienSchauen hat auch einen Newsletter: